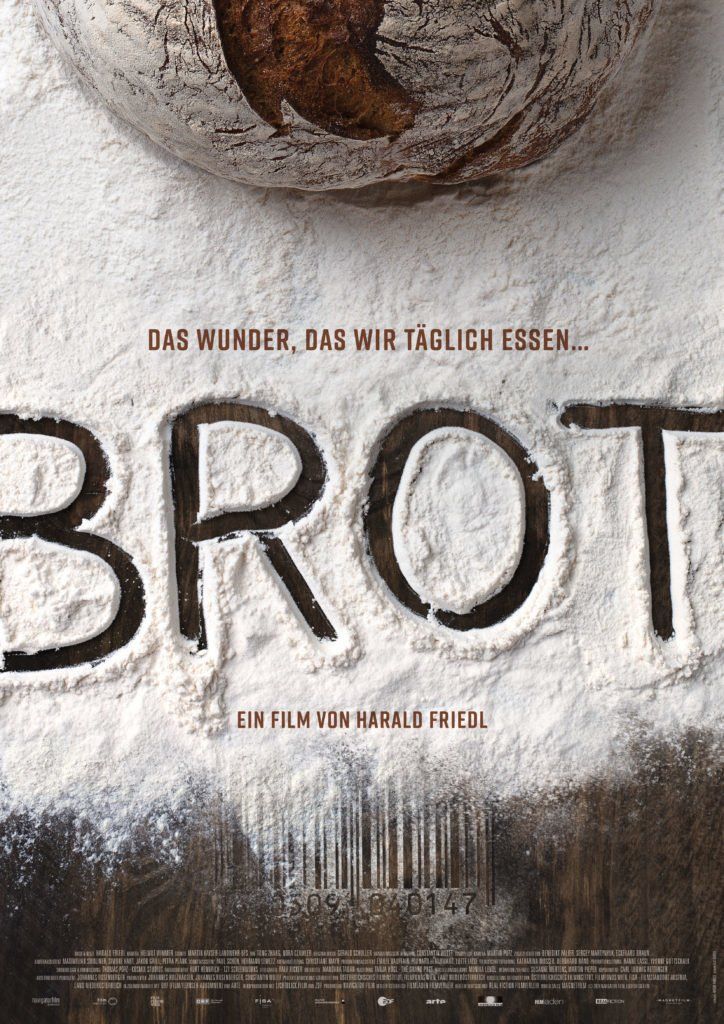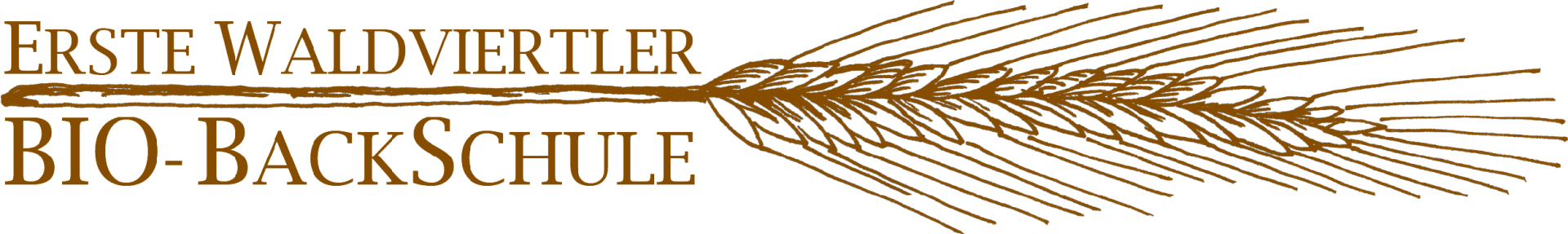von Elisabeth Ruckser
•
7. Juli 2020
BROT, der viel beachtete Film des österreichischen Filmemachers, Schriftstellers und Musikers Harald Friedl ist seit Juni wieder in unseren Kinos zu sehen. Kurz vor dem Lockdown konnten wir BROT ja zusammen mit dem Filmclub noch in einer Vorpremiere in Drosendorf zeigen, einen spannenden Film über Überzeugung und Begeisterung, über Handwerk und den Duft des Brotes, über Bio-Landwirtschaft, Politik und die Fakten aus der Lebensmittelindustrie. Und auch darüber, dass wir als Konsument*innen immer die Wahl haben. Eine Doku, die in der Tat nicht nur Brotbegeisterte sehen sollten. Ein Gespräch mit Harald Friedl. Lieber Harald, stürzen wir uns ins Thema, Stichwort Brot und die Corona-Krise. Was ist da mit uns passiert? Warum war Brot und Backen plötzlich so ein Thema? Hat diese Zeit der großen Unsicherheit in uns die Sehnsucht nach der Geborgenheit eines warmen Ofens geweckt? Brot ist das elementarste Lebensmittel. Und die Krise hat uns auf Elementares zurückgeworfen. Viele Selbstverständlichkeiten wurden mit einem Schlag erschüttert. Und plötzlich war sehr vieles möglich. Aus Angst ist es auf einmal möglich geworden, dass wir verantwortungsvolle Maßnahmen ergriffen haben. Um die Familie, die Kinder, die Alten zu schützen. Ich finde das beachtenswert: Breiteste Massen waren zu verantwortungsvollem Handeln fähig. Können wir da nicht weitermachen? Plötzlich ist enorm viel Geld da, um etwas zu schützen. Wow! Wir schützen etwas – und diesmal nicht den Finanzhandel! Du sagst, aus Angst haben wir so reagiert. Das ist für uns Menschen ein starker Beweggrund. Ich denke, dass uns Genuss und der nach Wunsch etwas Gutem, das ich erleben und spüren will, ebenso motivieren kann, „das Richtige“ zu tun, und über Zusammenhänge nachzudenken, etwa bei der Herstellung von Lebensmitteln. Das verstehe ich kurz gesagt unter Genussethik . Wie siehst Du das? Kann uns Genuss zu etwas Gutem motivieren? Genuss ist ebenso wichtig wie umfassend. Und Genuss muss man wie alles andere auch lernen – den Kunstgenuss und auch den Brotgenuss. Menschen, die nur gelernt haben, sich mit Toastbrot aus dem Plastikpackerl vollzustopfen, die muss man erst dazu hinführen, ein knuspriges Handwerks-Biokörndlbrot zu genießen. Ich behaupte jetzt einmal, dass viele Menschen heute nicht fähig sind zu genießen. Sie ziehen sich was Schnelles rein, egal ob das Musik, Kulinarik oder Filme sind. Genuss zu lernen sollte schon an Schulen stattfinden, in dem man Kunstausflüge abhält oder Genussmenschen einlädt und vieles mehr, was Kindern das Erleben von Genuss nahebringt. Dein Film Brot sagt viel über Biolandwirtschaft, über handwerkliche Herstellung und über die Brotindustrie. Gibt es etwas, das Dir da besonders am Herzen liegt oder das Du oft in Interviews beantwortest? Grundsätzlich sollte allein schon aus ökologischen Gründen jeder Biobrot essen. Aber ich erlebe es oft, dass jemand sagt: Naja, schön und gut, aber Bio-Handwerksbrot ist so teuer. Erstens könnte die Industrie längst Biobrot herstellen, das wäre ein guter Schritt und würde dann vielleicht 10 Cent mehr kosten. Und zweitens ist Bio-Handwerksbrot ein ganz anderes Lebensmittel, allein was den Nähr- oder Genusswert betrifft. Noch einmal zurück zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden: Was hat die Entwicklung der letzten Wochen mit uns gemacht? Angela Merkel hat kürzlich von disruptiven Phänomenen gesprochen, und das ist ohne Zweifel eines; ähnlich wie der Fall der Berliner Mauer 1989 oder die Weltfinanzkrise 2007. Allerdings war der Mauerfall nicht so global und die Finanzkrise ging so nicht so weit ins Privateste. Es ist in unserer Generation also ein Geschehen von bisher unbekannten Dimensionen. Was passiert da jetzt beziehungsweise wie wird oder kann es weitergehen, zum Beispiel bei der Herstellung von Lebensmitteln? Die Menschen stehen so sehr unter Druck, dass sie nicht die Muße haben sich Gedanken über einfache, alltägliche Dinge zu machen. In der Theorie etwa existiert das Wissen, dass es Zusammenhänge zwischen Boden und Bauch gibt oder zwischen Massenproduktion und Gesundheit. Das wissen viele irgendwie, aber führt zu keinen Konsequenzen. In einer Konsumkultur wird uns das Denken abgenommen, wir wurden zu gierigen selbstsüchtigen Kindern erzogen. Wir brauchen eine Ökologisierung von allem und eine Regionalisierung von manchem. Die Maßnahmen, die dazu notwendig sind, sind längst bekannt. Siehst Du eine Chance, dass sich Dinge positiver oder kurz gesagt besser entwickeln werden? Die Krise hat Gewissheiten in Frage gestellt, unsere Gesundheit, unsere Mobilität, die Globalität. Dinge haben sich verändert, das bringt einen Bewusstseinswandel. Die Frage ist, wie wird es weitergehen? Die Bemühungen sind stark, dass wir so schnell wie möglich zurückkehren zum Alten, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Das ist nicht sinnvoll und wird schlecht funktionieren, es ist zu viel geschehen. Was wir brauchen, sind neue wirtschaftliche Konzepte, allerdings ohne, dass man den Markt dafür heute schon kennt. Da werden wir kulturelle Schwächen sehr stark spüren, und eine davon ist: Wir leben in einer Kultur des Konsums, der schnellen Befriedigung, der Digitalisierung und oberflächlichen Vernetzung. Man hat nicht mehr gelernt zu träumen oder visionär zu sein. Da ist wohl auch die Politik gefragt …? Da sind die Denkfabriken gefragt und die Politik könnte sich daran orientieren. Wir brauchen die Soziologie, die Philosophie, die Ernährungswissenschaften, die Kunst, die Ökologie. Und so wie die Politik auf die Virologen hören konnte, soll sie jetzt mal diese anderen hören. Wir müssen schleunigst definieren, welche Art von Wirtschaft wir haben wollen und welche Art von Leben. Die Wissenschaft, die Politik und die Kunst müssen gemeinsame Signale aussenden. Dann können wir versuchen, eine Richtung zu definieren.